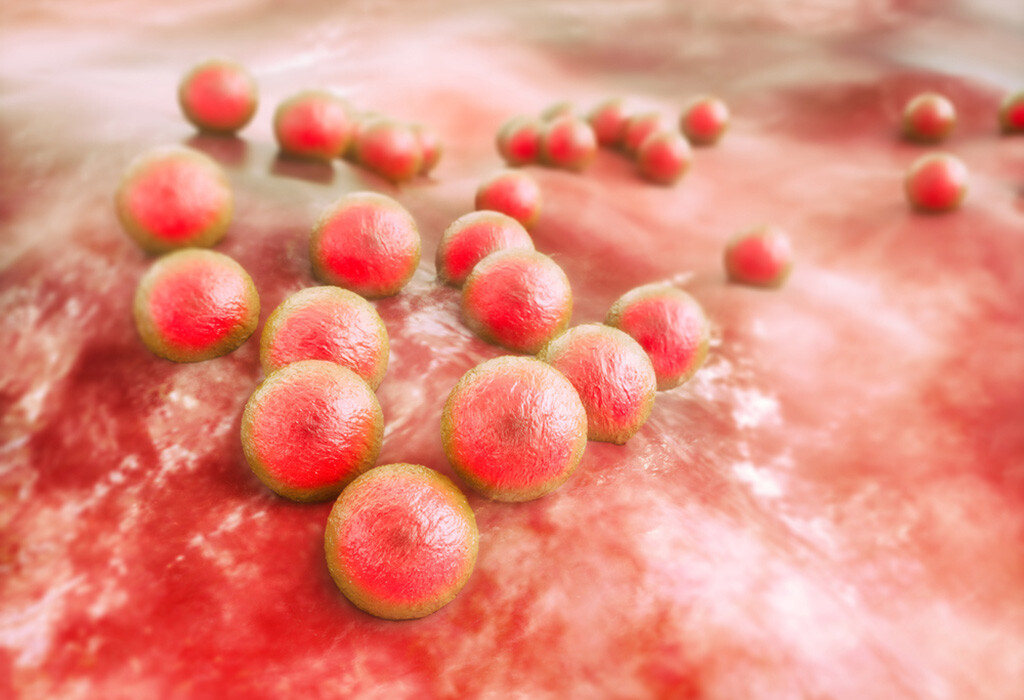Krankenhausinfektionen sind kostspielig für Spitäler und Volkswirtschaften. Der systematischen Umsetzung bewährter Prophylaxe-Maßnahmen muss größere Aufmerksamkeit zukommen.
Die konsequente Prävention von Krankenhausinfektionen – so genannter nosokomialen Infektionen – ist vielerlei Hinsicht wichtig. Damit könnte menschliches Leid, eine höhere Sterblichkeit, Behinderungen und Arbeitsunfähigkeit vermieden werden. Es führe aber auch zu Kosteneinsparungen für das betroffene Spital und die Volkswirtschaften, waren sich Experten bei einem Round Table der „Initiative Sicherheit im OP“ und der „Plattform Patientensicherheit“ einig.
4,1 Millionen Menschen erkranken in Europa jährlich an einer nosokomialen Infektion, zeigen Daten des European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Hochgerechnet 37.000 Menschen in der EU sterben zweifelsfrei als direkte Folge solcher Infektionen. Bei weiteren 110.000 Todesfällen, schätzt das ECDC, sind Krankenhausinfektionen zumindest mit verantwortlich. Umgerechnet auf Österreich wären das 2.400 Todesfälle.
Krankenhausinfektionen haben Konsequenzen für das gesamte Gesundheitswesen – und zwar im Hinblick auf Morbidität, Mortalität, Kosten, Qualitätssicherung und Patientenrechte. Österreichische Experten berichten beispielsweise, dass nosokomiale Infektionen generell zu einem relativen Anstieg der Mortalität um bis zu 50 Prozent und zu einer erhöhten Morbidität sowie zu einer verlängerten Einschränkung der Leistungsfähigkeit führen: Zum Beispiel brauchen Patienten nach einer nosokomialen Infektion eine Woche länger, bis sie ihrem Beruf wieder nachgehen können. Das führt zu zusätzlichen Aufenthaltskosten von 10.260 bis 13.680 Euro.[1] Die Behandlungskosten bei einer postoperativen Wundinfektionen, einer wichtigen Gruppe von NI, werden auf das 2,9-fache der Standard-Behandlungskosten geschätzt[2]. Britische Daten[3] zeigen, dass die Dauer einer stationären Behandlung für Patienten mit nosokomialen Infektionen 2,5 mal länger ist als die Dauer der stationären Behandlung vergleichbarer Patienten ohne Krankenhausinfektion. Die Mehrkosten betragen das 2,8fache der Kosten ohne NI.
In Österreich, so zeigte eine „Punktprävalenzuntersuchung“ aus dem Jahr 2012, erkranken 6,2 Prozent der Spitalspatienten an einer nosokomialen Infektion, berichtet Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Presterl, Vorstand der Universitätsklinik für Hygiene und Infektionskontrolle, Wien. „Am häufigsten sind Pneumonien, gefolgt von Harnwegsinfektionen und postoperativen Wundinfektionen. In rund der Hälfte der Fälle waren Multiresistenzerreger involviert.“ Derzeit wird die Untersuchung wiederholt. „Kosten sind dabei zwar nicht das primäre Thema, werden aber bei entsprechender Unterstützung berücksichtigt werden“, so Prof. Presterl.
Das Leid eines Patienten, der eine nosokomiale Infektion erleidet, lasse sich nicht in Kosten fassen, sagt Prof. Presterl. „Es ist also in erster Linie aus humanitär-ethischen Gründen unsere Aufgabe, alle Infektionen, die sich vermeiden lassen, zu vermeiden. Wenn man das mit dem Einsatz sachgerechter Hygiene tut, dann ist das natürlich darüber hinaus auch noch kosteneffektiv.“
Prophylaxe rechnet sich – Fehlende Personalressourcen als Risikofaktor
Dr. Thomas Hauer, Ärztlicher Leiter, Deutsches Beratungszentrum für Hygiene Freiburg, warnt vor einem zu selektiven Blick auf das Problem NI: „Das Thema Krankenhauskeime wird in der öffentlichen Debatte oft fokussiert auf die multiresistenten Erreger. Natürlich sind die ein massives Problem, aber wir dürfen nicht übersehen, dass bei wohl 85 Prozent der Fälle nicht resistente Erreger im Spiel sind, und die sollten keinesfalls vernachlässigt werden.“
Dies insbesondere deshalb, weil es ein hohes „Vermeidungspotenzial“ gibt, sich also ein nicht unerheblicher Teil aller Krankenhausinfektionen vermeiden ließen: Für Deutschland etwa gehen Studien von einem Präventionspotenzial von 20 bis 30 Prozent der nosokomialen Infektionen aus.[4]
Ökonomische Argumente können die Prophylaxe durchaus befördern, weiß Dr. Hauer aus Erfahrung: „Vielen Klinikmanagern muss man es vorrechnen, dass sie langfristig mit Investitionen in Hygiene Geld in ihren Häusern sparen können. Fachkundige Infektionsprävention vermeidet nicht nur die Kosten, die durch Behandlung, längere Liegedauer, allfällige Isolationsmaßnahmen, bei Ausbrüchen sogar Stationsschließungen etc. entstehen. Sie hilft auch, unnötige Prophylaxemaßnahmen einzusparen, zum Beispiel manche aufwändige technische Maßnahmen, die gar nicht nötig wären, und vermeidet kaum bezifferbare Imageschäden“, so Dr. Hauer. „Berücksichtigt man dann noch gesellschaftlich relevante Effekte wie das Vermeiden von Behinderung, Arbeitsunfähigkeit oder chronischen Ereignissen, ist klar: Infektionsprävention rechnet sich, schon ethisch und moralisch, aber auch auf Heller und Pfennig. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist sehr günstig für die Prävention.“
Eine wichtige Rolle in der Prophylaxe von Krankenhausinfektionen spielen ausreichende Personalressourcen, betont Dr. Hauer: „Wenn die Arbeitsbelastung zu hoch ist, fallen sozusagen die Hygienemaßnahmen hinten runter. Das bedeutet einerseits, dass wir ausreichend Fachärzte und Fachkräfte für Hygiene brauchen, dass die Hygieneteams ausreichend gut ausgestattet sein müssen. Aber es braucht generell eine ausreichend gute Personaldecke in allen Bereichen eines Krankenhauses. Es gibt viele Arbeiten die zeigen, dass eine hohe Arbeitsdichte ein wichtiger Risikofaktor für Krankenhausinfektionen ist. Aber es müssen natürlich auch Strukturen geschaffen werden, die die gewünschten Abläufe für das Personal umsetzbar machen, und wir dürfen die Motivation nicht vernachlässigen.“
Belege für längere Liegedauer – Gesundheitspolitik-Engagement lohnt sich
Die Konsequenzen von Krankenhausinfektionen konnten Univ.-Prof. Dr. Franz Allerberger, Bereichsleiter Humanmedizin in der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und seine Kollegen am Beispiel von Clostridium-difficile-Infektionen (CDI) nachweisen, einer der Hauptursachen für infektiöse Diarrhoe im Krankenhaus. Die Mortalität der von ihnen untersuchten CDI-Patienten vor der Entlassung, sowie 30 und 180 Tage danach lag bei 20, 17 und 42,3 Prozent – bei Patienten ohne CDI waren die entsprechenden Daten 7,2, 6,7 und 22,5 Prozent. Die Liegedauer hat sich bei CDI-Betroffenen gegenüber anderen Patienten um 10 Tage verlängert. Bei einem Fixkostenpreis von zumindest 500 Euro pro Bett pro Tag wären dies Zusatzkosten von 5.000 Euro pro CDI-Fall. Die tatsächlichen Kosten zuzuordnen, ist schwierig. Prof. Allerberger: „Über die verlängerte Liegedauer wird das Problem auch für den Krankenhausträger offensichtlich, weil es somit Auswirkungen auf die Kosten hat, und es wird deutlich, dass Prävention kosteneffektiv ist.“
Eine deutsche CDI-Studie zeigte eine Verlängerung der Verweildauer um durchschnittlich sieben Tage und erhöhten durchschnittlichen Behandlungskosten von etwas mehr als 7.000 auf 33.840 Euro.
Die Vermeidung dieser Belastung ist nicht nur Aufgabe jeder einzelnen Gesundheitseinrichtung, auch die Gesundheitspolitik sollte Prioritäten bei der Infektionsprävention setzen, so Prof. Allerberger: „In Großbritannien hat man Clostridium difficile zu einer gesundheitspolitischen Priorität gemacht und konnte tatsächlich die Zahl der Infektionen um 80 Prozent reduzieren. Das heißt, auch in Österreich wäre es möglich, jährlich einige hundert Todesfälle zu vermeiden. Dass die österreichische Hygiene-Leitline PROHYG 2.0 demnächst in der Bundeszielsteuerung verankert werden soll, ist ein gutes Signal in diese Richtung.“
Krankenhäuser sollten sich benchmarken lassen, zwölf österreichische Spitäler nehmen bereits freiwillig an einem derartigen Clostridium difficile-Surveillance-System teil.
Transparenz über tatsächliche Infektionsraten sei eine wichtige Voraussetzung dafür, Bewusstsein und Vertrauen zu schaffen und geeignete Maßnahmen zu treffen, so Prof. Allerberger: „Hier geht es nicht darum, Schuld zuzuweisen, sondern es ist ausgesprochen positiv, wenn Infektionsraten oder -ausbrüche öffentlich gemacht werden. Wenn es in den USA möglich ist, dass jedes Krankenhaus CDI- Infektionen und MRSA-Bakteriämien öffentlich machen muss, warum geht das dann bei uns nicht?“ Seine Überzeugung: „Auch in Österreich wird man nicht um die Transparenz herumkommen. Nur wenn man Infektionen erfasst, kann man besser werden.“
Krankenhausinfektionen sind ein schlechtes „Geschäft“ für Krankenhausträger
Konsequenzen nosokomialer Infektionen wie längere Liegedauer, längere Krankenstände, Arbeitsunfähigkeit belasten nicht nur das Gesundheitssystem und die Volkswirtschaften, sie sind im aktuellen österreichischen Abrechnungssystem auch für jedes Krankenhaus ein ungünstiger Kostenfaktor.
„Generell gibt es einen Bewusstseinswandel im System Krankenhaus, mehr auf das Problem nosokomiale Infektionen zu achten. Das Bewusstsein steigt, dass nosokomiale Infektionen ein wichtiger Kosten- und Qualitätsfaktor im Krankenhaus sind, und das ist eine positive Entwicklung“, so Univ.-Doz. Dr. Thomas Koperna, Leiter Unternehmensentwicklung – Medizin und Pflege, KABEG Management, Klagenfurt: „Die Literatur geht von einer zwei- bis dreifach verlängerten Verweildauer von Patienten mit nosokomialen Infektionen aus. Die österreichischen Krankenhäuser bekommen ihre Leistungen nach dem LKF-System pauschal abgegolten. Wenn nun ein Patient länger liegt, weil er eine Infektion hat, bringt diese aufwändigere Betreuung keine zusätzlichen Erlöse, verursacht aber zusätzliche Kosten. Abgesehen vom menschlichen Leid, das verursacht wird, ist es also für ein Krankenhaus auch ein schlechtes Geschäft.“
Welche Maßnahmen sollten Krankenhausträger also ergreifen, um ein möglichst hohes Maß an nosokomialen Infektionen zu vermeiden? „Es erweist sich jedenfalls als sinnvoll, dass Häuser bei Surveillance-Programmen mitmachen, denn schon dadurch wird man gezielter auf das Problem Infektionen achten. Jede Maßnahme gegen Krankenhaus-Infektionen wirkt sich finanziell aus“, empfiehlt Doz. Koperna. „Außerdem ist es wesentlich, gezielt solche Infektions-Präventionsprogramme einzusetzen, für deren Nutzen es ausreichende Evidenz gibt. Man sollte kein Geld in Maßnahmen stecken, deren Nutzen nicht klar belegt ist. Es gibt immer mehr Daten über bewährte Maßnahmen und es ist wünschenswert, dass wir weiter bisher weniger gut untersuchte Themen der Infektionsprophylaxe erforschen.“
Den Krankenhausverwaltern müsse man klar machen, dass Präventionsmaßnahmen zwar mit Kosten verbunden sind, aber auch finanziell etwas bringen. Auch der Imagefaktor spielt eine Rolle. Wenn ein Patient gesund ins Spital kommt und es mit einer Krankenhausinfektion verlässt, ist das schlecht für den Ruf eines Hauses.
Krankenhausinfektionen bringen heikle Haftungsfragen
„Nosokomiale Infektionen verursachen eine Körperverletzung, sie haben für betroffene Patienten Schäden zur Folge, gesundheitliche und oft auch finanzielle“, sagt so Dr. Maria Kletecka-Pulker vom Institut für Recht und Ethik in der Medizin, Generalsekretärin der Plattform Patientensicherheit. Und das habe für Krankenhäuser und Gesundheitsdienstleister auch haftungsrechtliche Folgen, wobei nicht zuletzt die Frage interessant sei, ob sie ihre Sorgfaltspflicht zur Verhinderung von Infektionen wahrgenommen haben. Es stellen sich nicht nur zivilrechtliche Fragen, sondern auch verwaltungs- und strafrechtliche. Nicht zuletzt hat das Thema durch das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, aufgrund dessen die Führung eines Krankenhauses strafrechtlich verfolgt werden kann, an Bedeutung gewonnen. Praktische Probleme sind die Frage der Nachweisbarkeit der Schuldhaftigkeit, die Beweislast liegt nämlich beim Patienten.
Bislang werden die Schäden, die ein Patient aufgrund von Spitalskeimen erleidet, häufig aus dem Entschädigungsfonds abgedeckt, welcher wiederum ausschließlich von Spitalspatienten finanziert wird. Dr. Kletecka-Pulker: „Ein Patient muss also einen Schaden, den andere verursacht haben, selbst tragen. Es wäre aber wünschenswert, dass die Verursacher für ihr Handeln zur Verantwortung gezogen werden und hier die Kosten für die Schäden zu tragen haben, um im Sinne der Qualität Verbesserungsmaßnahmen zu implementieren, damit nicht weitere Patienten zu Schaden kommen.“
Das Thema Haftung im Zusammenhang mit Krankenhausinfektionen wird in Zukunft wohl noch relevanter werden, meint Dr. Kletecka-Pulker. „In dem Ausmaß, in dem Patienten Krankenhaus-Infektionen nicht mehr als eine schicksalshafte Begleiterscheinung eines Spitalsaufenthalts akzeptieren, sondern Sicherheit einfordern, wird es in der Zukunft verstärkt zu Klagen und Schadenersatzbegehren kommen. Ich finde diese Entwicklung insofern positiv, als sich manche Dinge leider erst ändern, wenn rechtliche Konsequenzen drohen.“
Wenn in Österreich jedes Jahr geschätzt 2.400 Menschen aufgrund von nosokomialen Infektionen versterben, ist das weit mehr als im Straßenverkehr mit 430 Toten (2014). Dr. Kletecka-Pulker: „Würden im Straßenverkehr so viele Menschen zu Tode kommen wie durch nosokomiale Infektionen, würde die Politik wohl sofort Gegenmaßnahmen verordnen. Es ist höchste Zeit, auch gegen nosokomiale Infektionen aktiv zu werden.“
Hygiene-Kultur schaffen
Univ.-Prof. Dr. Norbert Pateisky, ehemals Gynäkologe und Risikomanager im AKH Wien und heute Mitglied des Vorstands, AssekuRisk Safety Management, Wien: „Es gibt sehr effektive Methoden zur Infektionsvermeidung, die oft nicht einmal Mehrkosten verursachen, aber sie werden nicht in ausreichendem Maß umgesetzt. Wir haben keine sinnvollen Anreizsysteme. Wir brauchen solche, damit die bekannten zweckmäßigen Maßnahmen konsequent umgesetzt werden. Bestehende Möglichkeiten werden viel zu oft ignoriert. Wir haben bei postoperativen Wundinfektionen in einem Projekt eine Reduktion um 70 Prozent erreicht.“
Es werde in der Infektionsprophylaxe oft noch der falsche Lösungsweg gegangen, nämlich der von oben verordneter Verhaltensweisen mit Androhung, Überwachung, Bestrafung. „Das funktioniert nicht oder immer nur kurzfristig“, so Prof. Pateisky. „Aber um dauerhaft eine Hygienekultur zu schaffen, muss man bei allen Mitarbeitern die entsprechende positive Einstellung generieren, das entsprechend schulen, immer wieder erinnern. Nudging, also laufendes Anstupsen, ist das neue Konzept. Erst die laufende Erinnerung macht eine Maßnahme nachhaltig wirksam. Wir müssen die Compliance stärken und die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass die Entscheidung für mehr Hygiene die einfachere Entscheidung ist. Das kann man nicht einheitlich für alle Spitäler in Österreich verordnen, sondern das muss, je nach Bedingungen, individuell umgesetzt werden.“